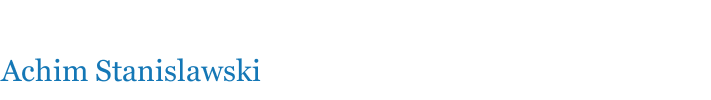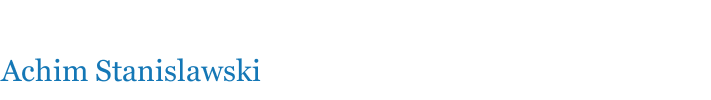Mixtape (Ein Werkstattbericht)
Was ist eigentlich eine Anthologie?
Eine Anthologie ist fast ein Mixtape. Da ich zu eben jener Generation gehöre, in der das präpubertäre Erwachen amouröser Gefühle mit der CD-Wende in der Musikbranche zusammenfiel, weiß ich noch aus eigener, wenn auch zarter und nur einmaliger Erfahrung, welche Arbeit vor der Zeit des CD-Brenners in die Zusammenstellung eines Mixtapes geflossen ist. Zu der diffizilen Songauswahl, die eine ganz bestimmte Parabelbahn zu einem vage drängenden Gefühls zeichnen sollte, die gleichzeitig anrührend und mitreißend- enthusiastisch zu sein hatte, kam vor allem die Schwierigkeit der Beschaffung der gewünschten Stücke und der unvermeidliche Kampf mit der Aufnahmetechnik. Mein erstes Mixtape, das für eine in allen wesentlichen Dingen natürlich schon viel weiter entwickelte Klassenkameradin gedacht war, ging aus einer jener herkulischen Anstrengungen hervor, die zwölfjährige Liebende damals erbringen mussten. Neben unzähligen Listen von Songtiteln und deren möglichen Anordnung (zirka 214 Möglichkeiten), die es zu erstellen galt, mussten die Songs beschafft und in einer unendlich frimmeligen Arbeit, bei der ich mit LPs und Kassetten von Freunden hantierte, irgendwie auf Band überspielt werden. Doch hatte diese Form des scheuen Liebesbeweises (Wie wird sie das Mixtape verstehen? Als Geste eines Freundes oder als romantische Avance?) einige unschlagbare Vorteile, da die Empfängerin im besten Falle wissen würde, wie viel handwerkliche Arbeit in solch einem Mixtape stecke. Bei der Kassettenaufnahme konnte man nicht einfach eine Liste aus dem Internett herunterladen, die restlichen Songs bei iTunes nachkaufen und dann bei dem stets diensteifrigen CD-Brenner in Bestellung geben. Die Kassette verlangte Aufmerksamkeit und unendliches Abwägen, denn man musste noch während der Aufnahme an der Anlage sitzen und jedes einzelne Lied mithören, um die Aufnahme an einem bestimmten Punkt zu stoppen. Der nicht einfach zu wählen war, denn wie viele Sekunden Pause konnte man der Angebeteten zwischen den Songs lassen, um sie in der süßen Erinnerung der Melodie schwelgen zu lassen, oder sollte das nächste Lied der Tracklist sie mitreißen, sie ohne Atempause nach einer tot-traurigen Ballade mit dem nächsten Stück in kathartischem Jubel entführen? Das mit Abstand Tollste an dieser langwierigen Bastelarbeit aber, war das Überspielen selbst, das Mithören all dieser Songs, die sich auf einmal zu einem Ganzen fügten, die eine geheime Verbindung untereinander zu offenbaren schienen. Wer konnte das hören, ohne unwiederbringlich gerührt zu sein, dieses Innenbeben von einem Mixtape?
Sie, die Sitznachbarin im Schatten junger Mädchenblüte, sie konnte es. Nahm die Kassette, bedankte sich artig und ließ nie, nie wieder, auch nicht in der zartesten Andeutung, erkennen, ob sie es überhaupt gehört hatte, ob sie verstanden hatte, was sich auf diesem beidseitig bespielten Band ereignete, aufgewickelt um Plastikspulen. Und trotzdem, und deshalb war diese erste Liebe nie größer gewesen als in den Abenden, in denen ich das Mixtape aufnahm, neben der Anlage saß und das Erwachen des Eros fühlte, mit dem Finger auf dem roten Knopf: „Rec.“
Die Reihe als Apparat
Das Herausgeben einer Anthologie ist in der Arbeitsweise dem Erstellen eines Mixtapes sehr ähnlich. D.h. es ist eine ähnlich antiquierte und sentimentdurchweichte Arbeit, die die Gefahr in sich birgt, sich in der Bastelei zu verlieren. Der Adressat (und mit ihm das angestrebte Ziel) ist jedoch ein völlig anderer. Die mysteriöse Mitschülerin, die wortwörtlich im Vorbeigehen einen Orkan unausdeutbarer Gefühle heraufbeschwören konnte, ist nun abgelöst worden von der noch viel schwieriger abzuschätzenden, ominösen und inkommensurablen „Leserschaft“.
„Die kleine Philosophie der Gaumenfreuden“ ist ein Papierbandprojekt, das im Rahmen der Reihe Fischer Klassik beim S. Fischer Verlag erscheint und kann deshalb nur als Teil dieser Reihe begriffen werden. Die Einbettung in eine Edition ist in gewisser Weise das Äquivalent zu dem Kassettendeck der Mixtapekultur. Denn wo der Apparat es nötig und möglich machte, sich die Auswahl der Songs auf der Trackliste genauestens zu überlegen (und sie alle immer und immer wieder zu hören), so macht es der der Anthologie der „Philosophie der Gaumenfreuden“ übergeordnete Reihecharakter nötig und möglich, die Textauswahl zu beschränken und mit Bedacht vorzunehmen. Die zwei wichtigsten Beschränkungen, die diesen Band einfädeln, sind die Voraussetzungen, dass erstens alle dort versammelten Texte von einem philosophischen Umgang mit den Gaumenfreuden und der Lust am Essen handeln sollten, und zweitens sollten dies alles klassische Texte sein. Nun kann man sich natürlich darüber streiten, welche Texte unter die erste der beiden Kategorien fallen. Warum zum Beispiel habe ich den geradezu genussfeindlichen Platon aufgenommen (und viel Raum gewährt) und gleichzeitig die Fragmente Epikurs, die futuristische Küche eines Filippo Tommaso Marinetti, den Opiumesser Thomas de Quincey, Sigmund Freuds Darstellungen „frühkindlicher Sexualität“, das Food-Kapitel aus „Tender Buttons“ von Gertrude Stein, gewisse Bemerkungen von Ludwig Wittgenstein oder die Sprachspiele der Oulipo-Poeten nicht aufgenommen? Bei diesen Beispielen gibt es natürlich von Einzelfall zu Einzelfall eine ganze Reihe unterschiedliche Gründe, die aus meiner Sicht gegen sie sprachen. Unter diesen war jedoch bei allen nicht berücksichtigten Texten immer einer ausschlaggebend: Die Frage, waren es „klassische“ Texte oder nicht, d.h. passten sie in die Reihe? Dabei fiel mir die Beantwortung dieser Frage äußerst leicht. Dies jedoch nicht, weil die Deutungsherrschaft über das Label „kanonischer Klassiker“ automatisch dem Kompetenzbereich eines Herausgebers überstellt würde. Gleich mit meiner ersten Anthologie rigoros zu beschließen, welcher Text sich den Ehrentitel Klassiker verdient hat, ganz so größenwahnsinnigen bin ich dann doch nicht – auch wenn ich natürlich zu jedem meine Meinung habe. Es galt hier eher pragmatisch zu verfahren, also nach dem Alter, das schon so manchen Text geadelt hat, und die wohl wichtigste Voraussetzung für den verlagstechnischen Begriff des „Klassikers“ ist. Für einen Verlag, der das irrwitzige Risiko eingeht einen No-name, d.h. einen der Leserschaft völlig Unbekannten – mich! – eine Klassikeranthologie gestalten zu lassen, ist es enorm wichtig, dass möglichst nur gemeinfreie Texte in dieser Sammlung aufgenommen werden. Das Wort Verlag hat seiner Etymologie gemäß eine ökonomische Bedeutung, denn es bedeutet nichts anderes als die Möglichkeit das Geld auf den Tisch zu legen, mit der der Druck eines Buches finanziert wird. Da aber der Zukauf von Rechten (auch im Fall von Übersetzungen) überaus teuer ist, kann ein Buchprojekt schon darin sich als Rohrkrepierer erweisen, dass allzu hohe Vorauslagen ihm den Garaus machen. Eine Klassikeranthologie eines unbekannten Schwärmers, der sich für vier Wochen in Texten verliert, um dann mit einem zusammengefrickelten Mixtape über den großen Schulhof zu stolzieren, lebt von dem Renommee des Verlages, der ihm diesen Traum ermöglicht hat, nicht umgekehrt. In dieser Hinsicht unterscheidet sich etwa Swetlana Geiers Neuübersetzung der fünf Elefanten Dostojewskijs und die wunderbaren Anthologien von Axel Ruckaberle oder Heinz Ludwig Arnold in der Fischer Klassiker Reihe fundamental von der „Kleinen Philosophie der Gaumenfreuden“. Die Leserschaft, der zwölfjährigen Mitschülerin in diesem Punkt nicht unähnlich, setzt zurecht eher auf die bewährte Kompetenz (eines Autors, nicht eines Liebhabers) und das durch die Peergroup in Gang gesetzte begehrliche Raunen: „Hast du den neuen Grass/Walser/Mosebach schon gelesen?“ Sie hat ihre Erfahrungen.
Für die Auswahl und Zusammenstellung der Texte in der Anthologie, erwies sich diese technische Beschränkung des Apparates aber als ein Segen, weil es verhinderte, dass der Band wie ein Hefeteig anschwoll. Es gibt, obwohl eine großer Teil der Philosophen nach Platon eher genussskeptisch und manchmal geradezu hedonephob sind, in der unendlich reichen Geschichte des Denkens natürlich mehr als genügend brillante Texte. Mehr als genug, um sich für immer darin zu verlieren – aber irgendwann muss das Manuskript fertig sein. Ein zweiter Gewinn, den die Konzentration auf gemeinfreie Texte mit sich brachte, ist die Erkenntnis, dass obwohl es einige überaus lesenswerte Lesebücher zum gleichen Themenbereich (in denen neben vielen Dichtern und Romanciers auch Philosophen zu Wort kommen) oder wissenschaftliche Arbeiten rund um die genießenden Denker gibt, mancher Schatz noch zu heben ist. So sind etwa die wunderbaren Satiren des Lukian in diesem Zusammenhang etwas in Vergessenheit geraten, auch die geradezu hyperbolische Fastentheologie des Ambrosius ist mit dem Abstand der Jahrhunderte umso lesenswerter. Seine Predigt, in der eine ganze Theologie in den archimedischen Punkt der Sünde der Völlerei fällt, ist so bizarr, dass sie wie auf einem anderen Stern geschrieben scheint. Die Ein- und Auslassungen wiederum der sogenannten Gastrosophen, die doch per definitionem die wahren enfants terribles und Küchenphilosophen sein sollten, bilden in ihrer obesitären Statuiertheit und gemaßregelten Dekadenz eine wunderbares Gegenstück zu den unglaublich mutigen und hemmungslos leidenschaftlichen Texten von Ludwig Feuerbach, Friedrich Nietzsche und allen voran Walter Benjamin.
Anthologien im digitalen Zeitalter
Eine Anthologie soll, genau wie ein Mixtape, verführen. Jedoch stellt sie sich nicht in den Dienst des Herausgebers, sondern ganz in den des Lesers. Sie ist im Idealfall ein Navigationsmittel in Buchform. Damit dieses Instrument gut funktioniert, muss viel Sorgfalt bei der Konzeption und bei der Ausführung aufgewandt werden. Das sind zwei Kompetenzbereiche eines großen Verlages wie S. Fischer, die ihn in der digitalen Zukunft nicht abschaffen, sondern noch wichtiger werden lassen. In einer Zeit der virtuellen Allverfügbarkeit praktisch jedes beliebigen Textes besteht die Aufgabe, die sich eine Anthologie stellen muss, gerade in der Auswahl und Aufbereitung von lesenswerten, ideenreichen, manchmal vergessenen Texten. In seinem Roman „Lokaltermin“ erzählt Stanisław Lem die Geschichte eines Besuches auf einem Planeten, in dem alles überhaupt mögliche Wissen bereits erforscht und abgespeichert ist. In solch einer virtuell allwissenden Kultur sind alle Wissenschaften notwendigerweise archäologische Wissenschaften. Denn das Übermaß an Informationen überfordert absolut. Die Arbeit der Wissenschaftler, der hilflosen Waterware im Angesicht der im doppelten Wortsinn unfassbaren Menge an Informationen, besteht nunmehr im „Wiederentdecken“ des inmitten der Datenberge unzugänglichen Wissens. Im gerade erst heranbrechenden digitalen Zeitalter des Textes sind wir zwar noch lange nicht an dem Punkt, den Lem in „Lokaltermin“ beschrieben hat. Doch wird es in Zukunft nicht leichter werden, ohne gewaltige Recherchearbeit überhaupt unter all den Creative Commons-Texten und den Produkte der Selfpublishing-Butzen bei digitalen Versandthegemonen einen interessanten Text zu finden. Ich wünsche mir, dass „Die kleine Anthologie der Gaumenfreuden“ in ihrer Buchform als ein haptisches Ausrufezeichen dafür verstanden wird, dass diese Navigation möglich und nötig ist. Weit davon entfernt den unendlichen Zusatzraum des Internets zu verteufeln, nutze ich ihn (auch mit diesem Werkstattbericht) als virtuelle Umlaufbahn, in dem weitere Texte, die es aus dem einen oder anderen Grund nicht ins Buch schafften, als Satelliten schweben. Sie sind meine hidden tracks, die am Ende eines Kassettenbandes oder einer CD nach einer langen Pause, wenn man vergessen hat die Anlage auszuschalten, plötzlich auftauchen. Sie sind nicht notwendig für das Konzept dieser Anthologie, aber sie sind nur verständlich als Satteliten dieses massereichen Dinges, das sich Buch nennt.
Dank
Ich möchte mich ganz herzlich bei Juliane Beckmann und Alexander Roesler vom S. Fischer Verlags bedanken, die es mir überhaupt erst ermöglicht haben, diese Anthologie zu machen, und mir mit ihrer Expertise stets hilfreich zur Seite gestanden haben. Ferner geht auch ein großes Dankeschön an Frank Geck, der den Band in der Herstellung betreut hat.