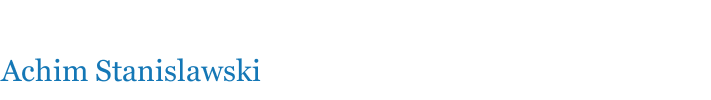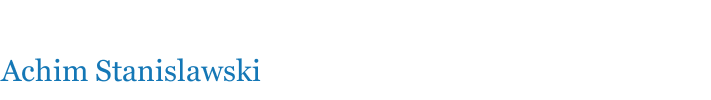Im Januar 2016 ist mein Ebook "Die Neuen Fabelwesen. Ein modernes Parazoologikon" im Verlag Culturbooks erschienen.
In diesem nicht ganz ernst gemeinten Pastichen-Buch auf eine Anthologie von Jorge Luis Borges präsentiere ich in kurzen Texten Phantasiewesen des 21. Jahrhunderts wie den Mailorderdemon, Forentroll, die Cyborg und das Raumschiff Erde.
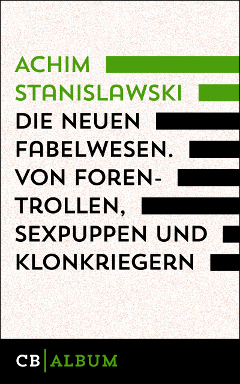
---------------------------------------------------
Bücher kaufen in Uganda
(erschienen in Literaturnachrichten 3/2014)

Aufschlagen, mit der Nase zuerst.
Wenn man in ein Land auf einem anderen Kontinent reist, kommt immer die Nase zuerst an. Kaum ist man noch etwas steif in den Knien aus dem Flieger gefallen, schon macht es sich bemerkbar, das gewaltige olfaktorische Neuland einer anderen Erde. Der Flughafen Entebbe empfing meine Nase mit einer Wolke aus Ozon, Staub und dem frühabendlichen Dunst des Viktoria-Sees. Wie ein Önologe schnüffelnd betrat ich afrikanischen Boden. Ich öffnete die Augen. Das war es also: Uganda, Land am Äquator.
Doch ich war nicht hierher gekommen, um bloß zu riechen. Ich wollte proustisch lesen, endlich afrikanische Autoren in Afrika lesen und neue Bücher kaufen. Meine schmale Reisebibliothek bestand aus den einzigen zwei ugandischen Romanen die ich während meiner Reisevorbereitung auftreiben konnte: „The Snakepit“ und „Abyssinian Chronicles“ von Moses Isegawa.

Femrite
Meine ersten Lesetipps holte ich mir bei Hilda von Femrite am folgenden Tag in Kampala. Der Verlag Femrite residiert in einem kleinen Häuschen an einer Ausfallstraße in der ugandischen Hauptstadt, dessen bibliophiles Interieur und die Freundlichkeit meiner Gastgeberin einen wunderbar warmen Kontrast zu dem verpesteten Moloch der Großstadt bilden. Wir unterhalten uns über die schwierigen Zustände auf dem ostafrikanischen Buchmarkt und Hildas Besuch auf der Frankfurter Buchmesse vor zwei Jahren. Femrite ist ein rein belletristischer Verlag, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Position der Frauen in der ugandischen Gesellschaft zu stärken. Zuhause würde man sagen: „Das ist so 70er-Jahre-Feminismus.“ Allerdings findet der Geschlechterkampf unter deutschen Verhältnissen doch mit ganz anderen Vorzeichen statt. Bei uns wird die gläserne Decke diskutiert, während die Frauen hier „aus Respekt“ so leise reden, wenn sie das Wort an einen (noch dazu weißen) Mann richten, dass ich sie kaum verstehe. Später lerne ich auf dem Land Frauen kennen, die sich bei der Begrüßung mit beiden Knien in den Staub werfen. Ganz anders dagegen Hilda, die zwei Stunden munter mit mir über Chimamanda Ngozi Adichies neue Erzählsammlung plaudert und aus dem Gedächtnis Derek Walcott zitiert. Zum Abschied zeigt sie mir ein Foto von Ngugi wa Thiong’o, auf dem sie ihm den „Femrite-Awareness-Award“ überreicht, und erklärt mir lachend, dass sie diesen Preis zu dem einzigen Zweck ausgelobt hat, um wa Thiong’o einmal persönlich kennenzulernen.
Noch völlig beglückt von dieser Unterhaltung entscheide ich mich dazu Kampala etwas per pedes zu erkunden. Das ist normalerweise der beste Weg, um eine Gefühl für eine fremde Stadt zu bekommen. Jedoch nicht im smogverseuchten, übermotorisierten Kampala. Ein irres Durcheinander von Motorrädern und den Matatus genannten Sammeltaxis schiebt sich durch die Straßen. Die Dieselwolken wabern wie fette Würmer über den Boden. Kampala hängt wie ein Petroleum-Junkie am Auspuffrohr. Nur die Bettelarmen, Ausgebrannten und Verrückten gehen hier zu Fuß, während die wenigen Weißen und die reichen Ugander in SUVs durch die Gegend juckeln. Abgeschottet in ihren Komfort-Wolken, in Villen hinter meterhohen Mauern sitzen sie „like goldfish in their glasses“, wie Isegawa schreibt. Dieser Goldfisch jedoch ließ sein Aquarium zu Hause und bekommt dafür reichlich Abgase zu schlucken. Ich muss an meinen Lieblingsdekadenzsatz in Obwlomov denken: „Ach du mein Gott, das Leben macht sich fühlbar, es erreicht einen überall.“
Der einzige größere Buchladen in Kampala befindet sich in einer Shopping-Mall mit angeschlossenem Golfplatz, die von einem Schwarm unheimlicher Marabus besetzt ist. Die importierten Bücher dort kosten einen durchschnittlichen Wochenlohn. Von Femrite habe sie nur zwei Bücher vorrätig: eine Anthologie und „Secrets no more“ von Goretti Kyomuhendo.
Weiß sein
„How are you Muzungo?“ ist der Satz mit dem mich jedermann auf der Straße begrüßt. Die Ugander scheinen ihr Herz auf der Zunge zu tragen und ein Muzungo (Lugunda für „Weißer“), der durch die einfach Straßen läuft, ist selbst in der Hauptstadt ein Kuriosum. Umso mehr in den kleineren Städten und ländlichen Gebieten. So lerne ich mit jedem Ausflug enorm viele aufgeschlossene und lustige Menschen kennen. Und doch birgt diese Floskel, die mir schon glucksende Kleinkinder durch ihre Rotzfahnen hindurch vorbrabbeln, eine Spitze. Weißsein kann man nicht ablegen. Der Muzungo ist bei mir, wenn ich versuche ein Matatu zu besteigen, er ist bei mir wenn mich Entwicklungshelfer oder Touristen komplizenhaft grüßen, als teilten wir irgendein geheimes Wissen. Er starrt mir aus dem Gesicht, wenn mich die Security des streng bewachten Shopping-Malls einfach durchwinkt. Byung-Chul Han war wohl doch etwas voreilig, als er den „hyperkulturellen Touristen“ zur wichtigsten Figur der globalisierten Zukunft erklärte. Nicht an diesem wirtschaftswissenschaftlichen Rand der Welt, der paradoxerweise genau in der Mitte des Globus, am Äquator liegt.
Hier ist man unweigerlich einer der Muzungos, deren allgegenwärtige Entwicklungssprech sich mindestens genauso tief in die Kultur dieses Landes eingegraben hat wie der Kolonialismus. Letzterer hat die Geschichte auszulöschen versucht, nun versucht man sich daran die Zukunft zu bestimmen. Was für ein Hohn, wenn ein örtlicher Ableger des big bank buisness, das zusammen mit dem IWF ein ganze Region der Erde in Schuldknechtschaft hält, sich „Pride Bank“ nennt. Uganda ist doch jetzt ein freies Land, wir haben jetzt „empowerment“, „liberalism“ und „development“ – und die widerlichen Marabus klacken mit ihren hässlichen Schnäbeln dazu. „Happiness is just around the corner“ verkündet ein Kreditgeber und illustriert das Ganze mit der ostafrikanischen Version des spießbürgerlichen Traums vom Eigenheim im Grünen, während unter dem Plakat ein Mädchen von ungefähr sieben Jahren drei einzelne Streifen Kaugummi den vorbeieilenden Passanten feilbietet. Ohne es zu wollen, muss ich an die fliehende Waise aus „Secrets no more“ denken. Das Mädchen sieht mich an und fragt unendlich freundlich: „How are you Muzungo?“
Alter Mann in Jinja
In Jinja sitzt im Mutatu ein Mann, Typ alte Blueslegende, neben mir. Ihm ist die Abyssinische Chronik aufgefallen, an der ich mich während der halsbrecherischen Fahrt festhalte. Er kennt das Buch, findet es aber etwas zu langatmig und verteidigt dagegen die Autobiographie von Wole Soyinka. Außer einer Bibel, die ihm ein paar missionierende Evangelikale geschenkt haben, hat er nie ein Buch besessen. Aber er hat viele Freunde, die ihm Bücher geliehen haben, weshalb sich sein ganzes Wissen aus der Erinnerung an diese Lektüren speist. Auf meine Frage hin, wo man in Jinja guten Stew essen könne, erzählt er mir von einem Lokal am Hafen, ganz in der Nähe der Nilquelle und ganz nebenbei, dass er heute außer gesüßten Tee noch nichts zu sich genommen hat. Als er aussteigt, schenke ich ihm mein Buch. Erst viel später realisiere ich, dass er mich trotz seines Hungers nicht um Geld gebeten hat.

Das Hemingway-Haus: Mbale
An der Grenze zu Kenia, hat vor hundert Jahren der gewiefte Klanchef Kakunguru Mbale erobert, die Stadt nach dem englischen Geschmack mit Alleen und Steinhäusern im Kolonialstil herrichten lassen und sie später gegen einen hohen militärischen Posten in Jinja eingetauscht. Das Wetter kann, weil die Stadt sich direkt am Fuße des Bergmassives Mount Elgon befindet, innerhalb kürzester Zeit umschlagen. Die wüste, unübersichtliche Geschichte, in der der trickreiche Kakunguru den Europäern eine schlüsselfertige Kolonialstadt baute, mischt hier sich in die afrikanischen Gegenwart, die so unbeständig scheint wie der Sonnenschein in Mbale. Ich wohne in einem wunderbar verkommenen Inn, das aus einem Hemingway-Roman stammen könnte. Ein gigantisches, verwuchertes Anwesen mit alten Kapokbäumen, die schmale Veranda mit Portikus, von dem der Putz abbröckelt. Ratten lärmen auf dem Dach. Eine eigenartige Zikadenart stimmt abends ein außerirdisch lautes Zirpen an, dass sich anhört wie ein Unfall im Umspannungswerk. Die indischen Besitzer haben keine Ahnung, wer das Haus erbaut hat, es schert sie auch nicht. Von den drei Zimmern des Hauses ist nur meines belegt. Ich sitze die ganze Nacht auf der Veranda, trinke African Tea und lese „The Snakepit“. Die immer singende Kellnerin hat meinen Namen falsch verstanden und nennt mich „Amin“ oder auch scherzhaft „Idi“. Sie arbeitet jeden Tag zehn Stunden.
Der einzige andere Gast ist das weiße Kaninchen Agnes, das in irgendeinem Busch auf dem Anwesen wohnt und abends zur Essenszeit immer auf die Veranda und von dort durch das kleine Fernseh- und Esszimmer direkt in die Küche hoppelt. In dieser eigenartigen Stadt, die in einem liminalen Zustand zu schweben scheint, hat Agnes die Vorzeichen der Geschichte umgedreht: Nicht der Mensch, das verzauberte Kaninchen ist durch den Spiegel gegangen.
In Mbale gibt es nur einen Secondhand-Buchladen, der außer einigen Titeln von Ngugi wa Thiong’o und Chinua Achebe nur alte eine Handvoll Penguin-Paperbacks aus den frühen 1980er Jahren führt. Jonas, der Besitzer des Landens, schüttelt den Kopf. Er hat leider keinen Hemingway auf Lager, erzählt mir aber die Geschichte, wie Hemingway dreimal fast in Uganda gestorben wäre.
Ich tausche den zuvor in Kampala gekauften Okot p’Bitek (Empfehlung von Hilda), den ich nicht verstanden habe, in Ermangelung eines Hemingways gegen eine alte Ausgabe „Alice’s Adventures in Wonderland“.
Die afrikanische Alice
In der Vorlesung: „The danger of a single story“ (kann im Internet nachgehört werden) erzählt Chimamanda Adichie, wie die Welt ihrer kindlichen Vorstellungskraft, weil es in ihrer Kindheit nur europäische Kinderbücher gab, von diesen Geschichten aus einer anderen Welt beeinflusst wurde. In den Phantasiewelten ihrer Kindheit lebten nur kleinen Mädchen mit blonden Haaren, die im Schnee spielten und Äpfel aßen. Daran muss ich denken, während ich an einem verregneten Tag im Inn bleibe und Carrolls Kinderbuchklassiker noch einmal lesen. Das weiße Kaninchen zeigt sich heute nicht im Esszimmer, dafür aber jemand anders:
Als ich in die Stadt gehe, um einige Postkarten einzuwerfen, kommt mir auf der nassen Straße eine kleine Person entgegen. Völlig unbeeindruckt von dem Regen, patscht sie barfuß durch die Pfützen und summt dabei, ganz in sich versunken, eine Melodie. Wer kann sagen, an was sie denkt, als sie geistesabwesend mein „How are you?“ nur mit einem knappen, breiten “Fine!“ beantwortet und mit einem Sprung seitwärts in der nächsten Pfütze landet. „The dream-child moving through a land/ Of wonders wild and new,/ In friendly chat with bird or beast –/ And half believe it true.”