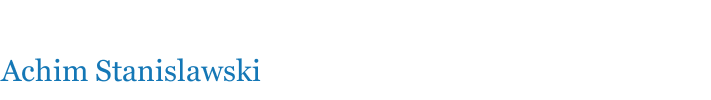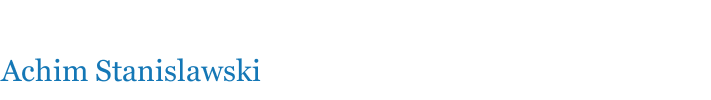Ende der Gaumenfreuden
Mit dem Genuss am Ende: Drei Vorschläge für zukunftsfähiges Genießen
Im Frühling 2012 saß ich an der Anthologie, die den schönen Titel „Die kleine Philosophie der Gaumenfreuden“ tragen sollte. Ziel war es, den philosophischen Diskurs über die lässliche Sünde der Freude am Essen auszubreiten, der auf der einen Seite einen Bogen von der Verteufelung des Epikurismus, die Askese der Kirchenväter bis hin zum Topos der Degradierung alles bloß Körperlichen bei Sokrates bis Kant schlagen sollte. Dieser diätetisch verbrämten Philosophie wollte ich auf der anderen Seite die kynische Freude am Derben und Ungekochten, die etwas manierierte Kunst der Gastrosophie, die Digestiv-Philosophie Nietzsches und Walter Benjamins zärtliche Liebe zum Essen entgegenhalten. Über diese Arbeit, die eher in der Historie dieser Philosophien vom Essen angesiedelt war, kam ich zwangsläufig auch ins Grübeln über den schalen Geschmack, der uns heutzutage die Genüsse verdirbt. Wir befinden uns heute, was die Verfügbarkeit des Genusses angeht, in einer welthistorisch einmaligen Lage. Keine Zeit vor uns hat so viele Mittel in Bewegung halten können, von den künstlichen Düngern, biotechnologisch verbesserten Pflanzen, der Tiefkühlung und nicht zuletzt der Veredelung all unserer Nahrungsmittel durch raffinierte Zubereitungsmethoden, um diesem einen Zweck zu dienen: Uns immer noch erlesenere, noch feinere Genüsse zu bereiten. Wir essen Erdbeeren im Winter, bei KFC gibt es nur noch Filet-Fleisch und wer es sich leisten kann, isst sowieso nur noch hypergesunde Bioware. Aber gerade deswegen, wegen dieser Allgegenwart des Genusses, scheint der Satz aus der Fastenpredigt des Basilius sich heute umso mehr zu bewahrheiten: „Denn nichts ist so begehrenswert, dass es nicht durch steten Genuss zum Ekel würde.“ All diese Genüsse, sie berühren uns nicht mehr.
Der geheime Ekel vor sich selbst, den die Moderne schon immer mit sich herumschleppt, er äußert sich heute, da alle Tore offen stehen, um große Lebensromane des Schwelgertums zu schreiben, in einem eigenartigen Feedback. Die großen, fetten Männer wie Orson Wells, Marlon Brando oder Peter Berling, die das Essen noch zelebrieren konnten (und können) sind abgemeldet. Ihre ausufernde Fähigkeit zu genießen und ihre ausufernde Leibesfülle erscheinen heute als widerwärtig deviant, ja als moralisch abstoßend. Denn die schlemmenden Hedonisten, die die Überschreitung jedes rechten Maßes lustvoll inszenieren konnten, werden heute ersetzt durch den Prototyp des Triathleten und seinen essgestörten Freuden. Ein Mann ist nur noch dann ein Mann, wenn er neben seinem High-Performer-Job auch noch für den nächsten Ironman auf Hawaii trainiert. Der Bär von einem Mann, der sich lachend auf die Schenkel klopft, während er den nächsten Gang heranwinkt, ist zu einem Relikt des mittelalterlichen Zeitgeistes geworden. (Von Frauen gar nicht zu reden, die durften in der Geschichte des Abendlandes ja nie wirklich genießen, ganz egal auf welchem Feld des Lustgewinns.)
Die Nährwerttabelle beginnt heute das Leben zu bestimmen, weil das größte soziale Distinktionsmerkmal wieder die Enthaltung von jeglicher Form von Ekstase ist. Essen kommt in diesen Köpfen nur noch als Ballaststoff vor. Der reine, elektrisierte Wille, unbeleckt von dem Ballast des Genießens und der Rast des Verdauenden, soll triumphieren, soll da wo Körper war, nackte Energie einsetzen.
Nur die Abgehängten, die Minderleister feiern noch, in einer Form primitivem Ritus, die Überschreitung der eigenen Körpergrenzen im Essen. Sie dehnen sich auf groteske Weise aus. Viele jedoch beginnen schon bald das mechanische Element dieser Form von unerfüllbarer Befriedigung zu verabscheuen. Es tritt eine ganzheitliche Sättigung ein, die aus einem Übermaß an Positivität, an Möglichkeit nur noch dann Lust ziehen kann, wenn der eigene Körper genossen werden kann. In der minutiösen Optimierung seines Ausstoßes an Kraft und der Stillstellung seines amorphen Charakters als fest gemeißeltes Körper-Designs offenbart sich diese neue Unfähigkeit etwas anderes zu genießen als sich selbst. Der Fitnessriegel und das isothonisch-alkoholfreie Bier sind zwei Meilensteine auf dem Weg in eine Gesellschaft der Genussunfähigkeit. Schon bald überkommt die Opinion-Leaders einen reflexartige Unlust gegenüber dem Essen.
Die Ursache für diese Abwehrreaktion liegt natürlich nicht in der Besorgnis um die Hungernden der Welt (das ist ein hypokritisches Argument). Es hängt vielleicht eher mit einer Szene aus „Das große Fressen“ von Marco Ferreri zusammen: In einer Szene wirft sich eine nackte Frau, einem spontanen Impuls folgend, auf eine mehrstockige Torte. Daraufhin springt Michel (Michel Piccoli) herbei, greift sich ein Stück von der nun völlig ramponierten Torte und beginnt die wunderschöne Nackte zu bewerfen, wobei er hysterisch „Vanitas, Vanitas!“ schreit. Diesem Bewusstsein, dass das Leben endlich und das Streben der Menschen eitel ist, so meine Vermutung, will sich in einer um das Vielfache beschleunigten Welt niemand mehr stellen. Und deshalb werden wir unfähig zu genießen, wie es die großen todessehnsüchtigen Ekstatiker noch vor vierzig Jahren vermocht haben.
Doch was hilft es dem vergangenen hinterzuweinen. Niemand dreht die Zeit zurück und schafft das Smartphone ab oder verbietet die Einfuhr von peruanischen Mangos im Januar. Unsere Hauptsorge sollte es daher sein, neue Wege des Genusses zu entwickeln, da die alten fade zu werden drohen. Man könnte hierzu vielleicht die Kunst in die Pflicht nehmen, insofern man, wie die Macher der documenta 12, „molekulare Küche“ als Kunstform sieht. Man könnte auch wie der alte Marinetti einfach eine neue Kochkunst einfordern, die die bestehende Kunst ablösen soll („Ein Suppenhuhn ist schöner als die Nike“ etc.). Aber dieser alte Traum der vorvorletzten Avantgarde, die Kunst ins Leben zu tragen, passt wohl doch eher in das 20 Jahrhundert. In der Transparenzgesellschaft wird sich der Künstler nicht mehr an dieser Grenze abarbeiten müssen. Vielleicht wird nach weiteren vierzig Jahre die Bemühung in der Kunstszene, den Bereich ihrer Aktivität in irgendeinem Maße von denen der übrigen Welt abzugrenzen (um diese Grenze dann ostentativ zu verwischen), auch nur als ein Versuch gesehen werden, alte Begriffe im Umlauf zu halten, damit die Kunstszene auch weiterhin Kapitalanlagen produzieren kann. Sophie Calles monochrome Menüs (LINK) wären dann vielleicht so etwas wie der letzte Nachhall dieser Bemühungen. Monochrome Menüs, mit ästhetischem Feingefühl inszeniert, aber ungenießbar.
Nein, was wirklich dringend notwendig wäre, ist die Entwicklung eines ganzen Sets neuer Genussarten, neuer Formen etwas zu genießen. Von diesen möchte ich nun drei vorstellen. Die Zahl ergibt sich aus dem einfachen Umstand, dass sie mir alle an einem Nachmittag eingefallen sind. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass der gewiefte Leser noch ein paar mehr (und zudem viel exquisitere) sich einfallen lassen wird.
I. Sensiblerer Geschmack durch Drogen
Bisher ist der Mensch ganz falsch an Drogen herangegangen. Die heute im Umlauf befindlichen Drogen sind Betäubungsmittel, die im besten Falle zu lustigen Eskapaden verleiten, und im schlimmsten zu einem so vollständigen Verlust der Sinne führen, dass man sich selbst in die Hose kackt. Nun wäre aber eine Droge wünschenswert, die nicht an alte schamanische Vorstellungen des Übertritts in die Geisterwelt und des Verlassens des Körpers gebunden ist. Statt Loslösung von der Erdenschwere und Traumwanderung sollte eine neue Generation von Drogen eine unendlich genaue Stimulanz möglich machen. Eine solche Droge, würde einen gewissen Bereich an Nerven an einer beliebigen Stelle des Körpers ultrasensibel für Reize machen. Eine Gaumenpille würde folglich den Geschmackssinn in einer Weise potenzieren, dass der Verzehr einer Rübe eine göttliche Erfahrung würde. Menschen, die diese neue Droge einnähmen, würden eine radikale Form des Genusses erleben, bei der extreme Lust und Unlust ineinander übergehen. Beim Essen würde man abwechselnd in Heulkrämpfe ausbrechen oder in wilder Wut das Tischtuch zerfetzen. Man würde sich an den banalsten Speisen wundschmecken, ein paar Salzkristalle mehr oder weniger im Essen könnten die Tore zu Himmel oder Hölle aufstoßen.
Dieser Vorschlag wäre aber natürlich – von der nicht selbstverständlichen Erfindung eines solchen Pille einmal abgesehen – die einfachste Strategie, um neue Formen des Genusses zu etablieren. Er ist also im Grunde banal, wenn auch aus pharmazeutischer Sicht nicht ganz so leicht umzusetzen. Denn wo anfangen, bei der Zunge oder im Hirn?
II. Unterlassungsgenuss
Andy Warhol hat neben eine Menge Quatsch einen wunderbaren Satz gesagt: „The idea of waiting for something makes it even more exciting.“ Die zweite Form eines zukunftsfähigen Genusses ist somit keine wirkliche neue Technik, die es erst aufwendig im Affekthaushalt zu finden gilt, denn die Idee ist schon vorhanden. Die Vorfreude ist jener wunderbare Schwebezustand, der Weihnachten so schön und einen schweren Job überhaupt erst erträglich macht, denn man kann sich im Büro schon auf den Urlaub freuen. Die Weichen sind also schon gelegt. Allein, es mangelt ein wenig an der Ausführung. Der Unterlassungsgenuss bestünde in der Freude an einer sehr aufwendigen Vorarbeit, deren eigentliches Ziel aber nie erreicht wird. Aus einer Tätigkeit Genuss zu ziehen, indem man ihr Telos verweigert, ist keine allzu schwierige Umgewöhnung. Jeder kann diese spezielle Art des Genusses neu erlernen und nach eigenem Belieben intensivieren. Wichtig ist allein, dass man die Arbeit, die in die Nicht-Erreichung eines Zieles steckt, mit stets steigendem Aufwand betreibt. Eine leichte Aufwärmübung wäre etwa das sorgsame Aussuchen einer Abendgarderobe, bei der jedes kleinste Detail exquisit und unendlich feinfühlig abgestimmt ist, die angezogen wird um gar nicht auszugehen. Wer daran Freude findet, kann sich an einem Parcours mit 100.000 Dominosteinen versuchen, die er niemals umgestoßen, sondern nach dem Aufbau einfach wieder abgebaut.
Die Möglichkeiten für solche Formen des Unterlassungsgenusses sind vielfältig und reichen von dem nicht angetretenen Bad in Schokopudding bis hin zu Himmelzeichnungen aus Steinen, die so groß sind, dass der Erbauer sie niemals selbst wird betrachten können. Das Wunderbare an dieser Form von Genuss ist, dass er zudem ein gesellschaftskritisches Element enthält, weil der eigentliche genusserfüllte Akt nicht in der Konsumtion liegt. Durch die Vorarbeit, die die teleologische Zurichtung unserer Umwelt aufhebt, kann man neben der Freude noch die Erfahrung erlangen, was es heißt, die Dinge wieder aus einer nicht rational-instrumentellen Warte aus zu betrachten. Das Puddingpulver, mit dem ich in mühevoller Arbeit die achtzig Liter Pudding anrühre, die es braucht um eine Badewanne zu füllen, wird genossen und dennoch aus dem Warenkreislauf herausgenommen, dessen Zirkulation durch den ständigen Imperativ der Konsumtion mir heute zur drückenden Last wird. Die Unterlassungslust ist in diesem Sinne ein interessanter Weg, um hinter die Dinge zu schauen und ihnen eine Autonomie wiederzugeben, die sie abermals genießbar macht.
III. Interpassiver Genuss
Die Interpassivität ist der Unterlassungslust verwandt. Geprägt wurde der Begriff von Robert Pfaller und Slavoj Žižek. Ihnen war aufgefallen, dass Kunstwerke immer öfter nach dem Prinzip der Interaktivität geformt werden, indem die aktive Produktion des eigentlichen Ereignisses nicht von dem Werk selbst geleistet wird, sondern von den Zuschauer, die interaktiv an der Ausgestaltung teilnehmen können, es sogar müssen, um das Kunstwerk hervorzubringen. Nun gibt es mittlerweile aber auch Apparaturen, die es ermöglichen Passivität zu delegieren, d.h. die die Konsumtion automatisch übernehmen. Das beste Beispiel für diese Form von Interpassivität ist das Gelächter, das bei amerikanischen Sitcoms an den vermeintlich lustigen Stellen eingespielt wird. Der Effekt, den die Produzenten sich von dieser Technik erhofft haben, mag ein anderer sein, aber er führt letztlich zu einer unsäglichen Erleichterung, speziell wenn die Witze schlecht sind. Denn die Maschine nimmt es mir ab zu lachen. Mit einem Videorekorder nimmt mir die Maschine mir sogar den Genuss selbst ab, denn ich brauche mir das Aufgenommene nicht mehr anzusehen, und „konsumiert“ ihn für mich. Laut Pfaller ist eines der wichtigsten Merkmale der Interpassivität, dass das zu Genießende durch einen Stellvertreter „restlos aufgebraucht“ wird. Dies kann eine Maschine sein, wie der Internetdienst, den man dazu programmieren kann, alle Songs eines Interpreten, die auf irgendeinem Internetsender gespielt werden, anzuhören und mitzuschneiden, oder der Videorekorder, der nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert. Diese Songs und die mitgeschnittenen Programme müssen dann auch von dem Besitzer dieser Geräte nicht mehr konsumiert werden, weil die Apparate es in gewisser Weise schon für ihn getan haben. Der Unterschied dieses technisch unterstützten, interpassiven Genusses zum Unterlassungsgenuss ist, dass derjenige, der das mühselige Genießen dieser Programme nicht selbst erledigen will, nicht viel Arbeit in die Programmierung stecken muss. Der eigentliche Genuss, der mit der Interpassivität angestrebt wird, hat seine affektiven Wurzeln also nicht in der Vorfreude, sondern in der Entspannung. Dennoch ist es etwas schwierig diese radikal neue Form des Genusses zu erlernen. Im Fall der Gaumenfreuden hieße dies, Genuss daraus zu ziehen, dass ein anderer die Speisen für mich genießt. Das vielleicht einfachste Beispiel ist wohl die Mutter, die Genuss aus dem Genuss ihres Kleinkindes am Essen ziehen kann. Allerdings handelt es sich hier noch nicht um eine reine Form der Interpassivität, denn die Mutter hat nicht ihre eigene Passivität auf den Säugling delegiert, sondern ist um sein Wohlergehen besorgt. Eine echte Form interpassiven Genusses wäre es, einem fremden auf der Straße anzusprechen, ihn mit in eine Bar zu nehmen und ihm dabei zuzusehen, wie er ein spendiertes Glas Bier austrinkt. Denkbar wäre auch ein Diner-Verstreter, den man engagieren kann, um im feinsten Lokal der Stadt für einen ein Hummermenü zu essen. Auf diese Weise werden sogar zwei Gaumenfreunde auf einmal glücklich.